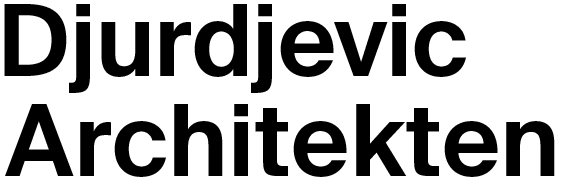014 Gesundheitspol und Aktivitäten, Fribourg
Verfahren: Studienauftrag mit Präqualifikation
Auftraggeber: Kanton Fribourg, Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt
Zeitraum: 2023–24
Geschossfläche Kantonsspital 150’000 m2, Universitätscampus 20’000 m2, Gewerbe 530’000 m2
Projektperimeter: 1’200’000 m2 (120 ha)
Nutzungen: Kantonsspital (HFR), Industrie und Gewerbe, Dienstleistung, Bildung, Parking, Kommerziel
Städtebau (Pilot): Djurdjevic Architekten, Lausanne
Muriz Djurdjevic (Projektleiter)
Architektur: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Wiktor Kacprzak, Béla Steiner
Architektur: IB+, Lausanne
Marwen Feriani, Georgia Malapani
Landschaft: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco, Ludovic Heimo
Nachhaltigkeit: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz, Juliette Vincent
Nachhaltigkeit: GXN Innovation, Copenhague
Mattia di Carlo, Carolina Felix
Verkehr: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer
Visualisierung: Ferala, Basel
RESILIO: Eine Strategie für Gleichgewicht, Resilienz und Innovation
Das Projekt RESILIO verkörpert eine langfristige strategische Vision, die auf Resilienz gegenüber Unsicherheiten und der notwendigen Flexibilität in einer sich ständig wandelnden Welt basiert. Es handelt sich um den robustesten und risikoärmsten Ansatz, der den Anforderungen des Pflichtenhefts vollständig entspricht und gleichzeitig Anpassungsspielräume offenhält. Diese Herangehensweise garantiert mehrere Ebenen des Erfolgs, auch bei einer schrittweisen Umsetzung, und sichert die Nachhaltigkeit der strategischen Grundausrichtung.
Genügsamkeit: Mit dem Bestehenden arbeiten
RESILIO setzt auf das bereits Vorhandene, wodurch sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Kosten reduziert werden. Anstatt das Gebiet stark zu versiegeln, verfolgt das Projekt einen schrittweisen und reversiblen Entwicklungsansatz, der eine kontinuierliche Neubewertung der Bedürfnisse ermöglicht. Auch im kleinen Massstab bleibt die Funktionsfähigkeit gewährleistet, ohne künftige Entwicklungen des Areals zu blockieren.
Resilienz: territorial und planerisch
Wir verfolgen eine zweifache Resilienzstrategie: territorial, durch den Schutz fruchtbarer Böden als nicht erneuerbares Gemeingut; strategisch, durch eine offene, ressourcenschonende und partizipative Planung. Der vorgeschlagene Städtebau minimiert neue Versiegelungen und fördert einen partizipativen Prozess mit allen Anspruchsgruppen. Dadurch wird das Risiko von Einsprachen oder Widerstand durch Anwohner und Umweltorganisationen deutlich reduziert.
Für den Gesundheitscampus und das neue Spital bietet der gewählte Standort mehrere Vorteile: sofortige Verfügbarkeit des Grundstücks, bestehende Anschlüsse an die nötige Infrastruktur (Wasser, Strom etc.), sowie fundierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse.
Diese Faktoren reduzieren zentrale Projektrisiken, verkürzen die Realisierungszeit um mehrere Jahre und senken die Umsetzungskosten deutlich.
Voraussicht und Anpassungsfähigkeit
Das Projekt schafft einen rechtlichen und physischen Rahmen, der die Ansiedlung wirtschaftlicher Aktivitätenbegünstigt, die mit den klima- und wirtschaftspolitischen Zielen des Kantons übereinstimmen. Die bewusst geringe Bodenversiegelung sichert eine hohe Flexibilität für künftige Bedarfsveränderungen und gewährleistet strategische Bodenreserven für Gemeinde und Kanton.
Beim Spital ermöglicht ein flexibler Bau- und Zeitplan sowie die anpassbare Dimensionierung des Gebäudes den Erhalt möglichst vieler Entwicklungsmöglichkeiten über einen langen Zeitraum hinweg.
Innovation: Ein Campus im Herzen der Freiburger Synergien
RESILIO schlägt die Entwicklung eines Innovationscampus vor – ein Impulsgeber für die nationale und internationale Sichtbarkeit von Villars-sur-Glâne und Fribourg.
Dieser Campus liegt an einem strategischen Knotenpunkt zwischen:
– den Produktionsstätten von Moncor,
– dem agroökologischen Landwirtschaftspark,
– und dem Gesundheits- und Forschungscampus.
Er ist als industrielles Ökosystem konzipiert, das Clean-Tech, angewandte Forschung und nachhaltige Produktionmiteinander verbindet. Dadurch würde Bertigny zur Eingangspforte von Fribourg und zu einem Zentrum für zukunftsfähige Technologien und Wertschöpfung in der Region.
Landschaftskonzept
Das Projekt basiert auf zwei grundlegenden Prinzipien, die vom Freiburger Territorium inspiriert sind: dem urbanen Block und der landwirtschaftlichen Landschaft. Die Vegetation bildet dabei das zentrale Element, das sich durch die gesamte Zone zieht, sei es in bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Bereichen. Sie schafft einen verbindenden biologischen Korridor, der ökologische und visuelle Verbindungen zwischen den verschiedenen Quartieren herstellt.
Die Anordnung des neuen Spitals wurde so konzipiert, dass es die Skyline von Fribourg prägt: Ein markantes Gebäude, das von Weitem sichtbar ist und den Patienten privilegierte Ausblicke auf die Alpen und das Jura bietet. Im Norden wird der Agri-Parc sich zu agroforstwirtschaftlichen Feldern entwickeln, entlang einer landschaftlichen Struktur, die von Hecken und Baumreihen (Keyline-System) begleitet wird, die den Höhenlinien folgen. Diese Pflanzungen erfüllen eine doppelte Funktion: Sie schaffen eine widerstandsfähige und ernährungsfördernde Landschaft und liefern ergänzendes Futter in Trockenperioden.
Gartenbauflächen, Spaziergänge und verschiedene pädagogische sowie Freizeitnutzungen werden diesen Raum beleben und ihn für alle zugänglich und aneignbar machen. Der Agri-Parc ist nach einem flexiblen Raster strukturiert, das in unterschiedlichen Maschenweiten parzelliert wird, um verschiedene Bedürfnisse seiner Nutzer zu erfüllen: Einzelpersonen (Gemüsegärten), Vereine (Mikro-Farmen) und Berufspioniere (Gemüseanbau oder Heckenflächen).
Die kontinuierliche Vegetation und der Schutz der lokalen Baumkronen verstärken die ökologische Integration und die Verknüpfung zwischen den kultivierten Parzellen. Die Beständigkeit des Ortes beruht auf der gemeinsamen Erfahrung, die sich hier entwickeln wird. Der Agri-Parc wird von einem hybriden urbanen Randgebiet eingefasst, das halb bebaut, halb vegetativ ist und eine sanfte und konstruktive Übergangszone zwischen Stadt und Natur bildet. Dieser Rand wird die institutionelle Farm, soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in leichten Bauten beherbergen, die darauf ausgelegt sind, das Nachbarschaftsleben zu fördern. Als echte Schnittstelle zwischen der Stadt und der Natur bildet er eine lebendige Haut zwischen dem urbanen Raum und dem Park.
Erhaltung von fruchtbaren und landwirtschaftlich nutzbaren Böden
Eine gründliche pedologische Analyse des Gebiets, das die Familiengärten, die Mikro-Farm von Bertigny und den zukünftigen Agrarpark umfasst, hat die am besten geeigneten Zonen für das Wurzelwachstum von Pflanzen identifiziert. Diese Studie stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität in das urbane Entwicklungskonzept zu integrieren, insbesondere in derzeit degradierten Bereichen.
Deutliche Unterschiede in der nutzbaren Bodentiefe wurden auf dem gesamten Gelände festgestellt. Im Norden der Autobahn beträgt die durchschnittliche Bodentiefe etwa 30 cm, was einem rekonstruierten Boden auf einem Autobahnumschüttungsbereich entspricht. Im Süden variiert diese Tiefe jedoch zwischen 70 cm und 1 Meter, was auf eine deutlich bessere Wurzeltiefe hinweist.
Der am besten geeignete Bereich für die Pflanzung von großwüchsigen Bäumen liegt im Zentrum des Agrarparks, wo die Böden am tiefsten sind. Im Gegensatz dazu weist das Gebiet zwischen dem Quartier Villars-Vert und der Ein- bzw. Ausfahrt zur Autobahn, das näher an den Infrastrukturen liegt, flachere Böden auf. Daher wurde dieses Gebiet vorrangig für die Entwicklung von Infrastrukturen und Gebäuden innerhalb der strategischen Reservezonen reserviert.
Eine Strategie zur Wiederherstellung der Böden ist vorgesehen, insbesondere durch die Wiederverwertung und Umpositionierung der pedologischen Horizonte A, B und C aus den Aushubmaterialien. Dieser Ansatz wird es ermöglichen, die abgemagerten Böden, insbesondere im Norden und entlang der Autobahn, zu verbessern.
Gleichzeitig werden die fruchtbareren Böden des Agrarparks schrittweise aufgewertet und optimiert. Verschiedene Ersatzbiotope werden geschaffen, um den Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden (COS) zu erhöhen und die Biodiversität zu fördern: Unbefahrbare Dauerwiesen, Feuchtgebiete und bewaldete Flächen werden die derzeit intensiv genutzten Ackerflächen teilweise ersetzen.
Diese Transformation wird dazu beitragen, die CO₂-Speicherkapazität und die Wasserrückhaltefähigkeit der Böden zu erhöhen und gleichzeitig ihre langfristige Resilienz zu sichern. In Kombination mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken wird sie die Erhaltung und Akkumulation von organischem Kohlenstoff in den Ackerböden fördern.
Verfahren: Studienauftrag mit Präqualifikation
Auftraggeber: Kanton Fribourg, Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt
Zeitraum: 2023–24
Geschossfläche Kantonsspital 150’000 m2, Universitätscampus 20’000 m2, Gewerbe 530’000 m2
Projektperimeter: 1’200’000 m2 (120 ha)
Nutzungen: Kantonsspital (HFR), Industrie und Gewerbe, Dienstleistung, Bildung, Parking, Kommerziel
Städtebau (Pilot): Djurdjevic Architekten, Lausanne
Muriz Djurdjevic (Projektleiter)
Architektur: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Wiktor Kacprzak, Béla Steiner
Architektur: IB+, Lausanne
Marwen Feriani, Georgia Malapani
Landschaft: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco, Ludovic Heimo
Nachhaltigkeit: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz, Juliette Vincent
Nachhaltigkeit: GXN Innovation, Copenhague
Mattia di Carlo, Carolina Felix
Verkehr: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer
Visualisierung: Ferala, Basel
RESILIO: Eine Strategie für Gleichgewicht, Resilienz und Innovation
Das Projekt RESILIO verkörpert eine langfristige strategische Vision, die auf Resilienz gegenüber Unsicherheiten und der notwendigen Flexibilität in einer sich ständig wandelnden Welt basiert. Es handelt sich um den robustesten und risikoärmsten Ansatz, der den Anforderungen des Pflichtenhefts vollständig entspricht und gleichzeitig Anpassungsspielräume offenhält. Diese Herangehensweise garantiert mehrere Ebenen des Erfolgs, auch bei einer schrittweisen Umsetzung, und sichert die Nachhaltigkeit der strategischen Grundausrichtung.
Genügsamkeit: Mit dem Bestehenden arbeiten
RESILIO setzt auf das bereits Vorhandene, wodurch sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Kosten reduziert werden. Anstatt das Gebiet stark zu versiegeln, verfolgt das Projekt einen schrittweisen und reversiblen Entwicklungsansatz, der eine kontinuierliche Neubewertung der Bedürfnisse ermöglicht. Auch im kleinen Massstab bleibt die Funktionsfähigkeit gewährleistet, ohne künftige Entwicklungen des Areals zu blockieren.
Resilienz: territorial und planerisch
Wir verfolgen eine zweifache Resilienzstrategie: territorial, durch den Schutz fruchtbarer Böden als nicht erneuerbares Gemeingut; strategisch, durch eine offene, ressourcenschonende und partizipative Planung. Der vorgeschlagene Städtebau minimiert neue Versiegelungen und fördert einen partizipativen Prozess mit allen Anspruchsgruppen. Dadurch wird das Risiko von Einsprachen oder Widerstand durch Anwohner und Umweltorganisationen deutlich reduziert.
Für den Gesundheitscampus und das neue Spital bietet der gewählte Standort mehrere Vorteile: sofortige Verfügbarkeit des Grundstücks, bestehende Anschlüsse an die nötige Infrastruktur (Wasser, Strom etc.), sowie fundierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse.
Diese Faktoren reduzieren zentrale Projektrisiken, verkürzen die Realisierungszeit um mehrere Jahre und senken die Umsetzungskosten deutlich.
Voraussicht und Anpassungsfähigkeit
Das Projekt schafft einen rechtlichen und physischen Rahmen, der die Ansiedlung wirtschaftlicher Aktivitätenbegünstigt, die mit den klima- und wirtschaftspolitischen Zielen des Kantons übereinstimmen. Die bewusst geringe Bodenversiegelung sichert eine hohe Flexibilität für künftige Bedarfsveränderungen und gewährleistet strategische Bodenreserven für Gemeinde und Kanton.
Beim Spital ermöglicht ein flexibler Bau- und Zeitplan sowie die anpassbare Dimensionierung des Gebäudes den Erhalt möglichst vieler Entwicklungsmöglichkeiten über einen langen Zeitraum hinweg.
Innovation: Ein Campus im Herzen der Freiburger Synergien
RESILIO schlägt die Entwicklung eines Innovationscampus vor – ein Impulsgeber für die nationale und internationale Sichtbarkeit von Villars-sur-Glâne und Fribourg.
Dieser Campus liegt an einem strategischen Knotenpunkt zwischen:
– den Produktionsstätten von Moncor,
– dem agroökologischen Landwirtschaftspark,
– und dem Gesundheits- und Forschungscampus.
Er ist als industrielles Ökosystem konzipiert, das Clean-Tech, angewandte Forschung und nachhaltige Produktionmiteinander verbindet. Dadurch würde Bertigny zur Eingangspforte von Fribourg und zu einem Zentrum für zukunftsfähige Technologien und Wertschöpfung in der Region.
Landschaftskonzept
Das Projekt basiert auf zwei grundlegenden Prinzipien, die vom Freiburger Territorium inspiriert sind: dem urbanen Block und der landwirtschaftlichen Landschaft. Die Vegetation bildet dabei das zentrale Element, das sich durch die gesamte Zone zieht, sei es in bebauten oder landwirtschaftlich genutzten Bereichen. Sie schafft einen verbindenden biologischen Korridor, der ökologische und visuelle Verbindungen zwischen den verschiedenen Quartieren herstellt.
Die Anordnung des neuen Spitals wurde so konzipiert, dass es die Skyline von Fribourg prägt: Ein markantes Gebäude, das von Weitem sichtbar ist und den Patienten privilegierte Ausblicke auf die Alpen und das Jura bietet. Im Norden wird der Agri-Parc sich zu agroforstwirtschaftlichen Feldern entwickeln, entlang einer landschaftlichen Struktur, die von Hecken und Baumreihen (Keyline-System) begleitet wird, die den Höhenlinien folgen. Diese Pflanzungen erfüllen eine doppelte Funktion: Sie schaffen eine widerstandsfähige und ernährungsfördernde Landschaft und liefern ergänzendes Futter in Trockenperioden.
Gartenbauflächen, Spaziergänge und verschiedene pädagogische sowie Freizeitnutzungen werden diesen Raum beleben und ihn für alle zugänglich und aneignbar machen. Der Agri-Parc ist nach einem flexiblen Raster strukturiert, das in unterschiedlichen Maschenweiten parzelliert wird, um verschiedene Bedürfnisse seiner Nutzer zu erfüllen: Einzelpersonen (Gemüsegärten), Vereine (Mikro-Farmen) und Berufspioniere (Gemüseanbau oder Heckenflächen).
Die kontinuierliche Vegetation und der Schutz der lokalen Baumkronen verstärken die ökologische Integration und die Verknüpfung zwischen den kultivierten Parzellen. Die Beständigkeit des Ortes beruht auf der gemeinsamen Erfahrung, die sich hier entwickeln wird. Der Agri-Parc wird von einem hybriden urbanen Randgebiet eingefasst, das halb bebaut, halb vegetativ ist und eine sanfte und konstruktive Übergangszone zwischen Stadt und Natur bildet. Dieser Rand wird die institutionelle Farm, soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in leichten Bauten beherbergen, die darauf ausgelegt sind, das Nachbarschaftsleben zu fördern. Als echte Schnittstelle zwischen der Stadt und der Natur bildet er eine lebendige Haut zwischen dem urbanen Raum und dem Park.
Erhaltung von fruchtbaren und landwirtschaftlich nutzbaren Böden
Eine gründliche pedologische Analyse des Gebiets, das die Familiengärten, die Mikro-Farm von Bertigny und den zukünftigen Agrarpark umfasst, hat die am besten geeigneten Zonen für das Wurzelwachstum von Pflanzen identifiziert. Diese Studie stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenqualität in das urbane Entwicklungskonzept zu integrieren, insbesondere in derzeit degradierten Bereichen.
Deutliche Unterschiede in der nutzbaren Bodentiefe wurden auf dem gesamten Gelände festgestellt. Im Norden der Autobahn beträgt die durchschnittliche Bodentiefe etwa 30 cm, was einem rekonstruierten Boden auf einem Autobahnumschüttungsbereich entspricht. Im Süden variiert diese Tiefe jedoch zwischen 70 cm und 1 Meter, was auf eine deutlich bessere Wurzeltiefe hinweist.
Der am besten geeignete Bereich für die Pflanzung von großwüchsigen Bäumen liegt im Zentrum des Agrarparks, wo die Böden am tiefsten sind. Im Gegensatz dazu weist das Gebiet zwischen dem Quartier Villars-Vert und der Ein- bzw. Ausfahrt zur Autobahn, das näher an den Infrastrukturen liegt, flachere Böden auf. Daher wurde dieses Gebiet vorrangig für die Entwicklung von Infrastrukturen und Gebäuden innerhalb der strategischen Reservezonen reserviert.
Eine Strategie zur Wiederherstellung der Böden ist vorgesehen, insbesondere durch die Wiederverwertung und Umpositionierung der pedologischen Horizonte A, B und C aus den Aushubmaterialien. Dieser Ansatz wird es ermöglichen, die abgemagerten Böden, insbesondere im Norden und entlang der Autobahn, zu verbessern.
Gleichzeitig werden die fruchtbareren Böden des Agrarparks schrittweise aufgewertet und optimiert. Verschiedene Ersatzbiotope werden geschaffen, um den Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden (COS) zu erhöhen und die Biodiversität zu fördern: Unbefahrbare Dauerwiesen, Feuchtgebiete und bewaldete Flächen werden die derzeit intensiv genutzten Ackerflächen teilweise ersetzen.
Diese Transformation wird dazu beitragen, die CO₂-Speicherkapazität und die Wasserrückhaltefähigkeit der Böden zu erhöhen und gleichzeitig ihre langfristige Resilienz zu sichern. In Kombination mit nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken wird sie die Erhaltung und Akkumulation von organischem Kohlenstoff in den Ackerböden fördern.