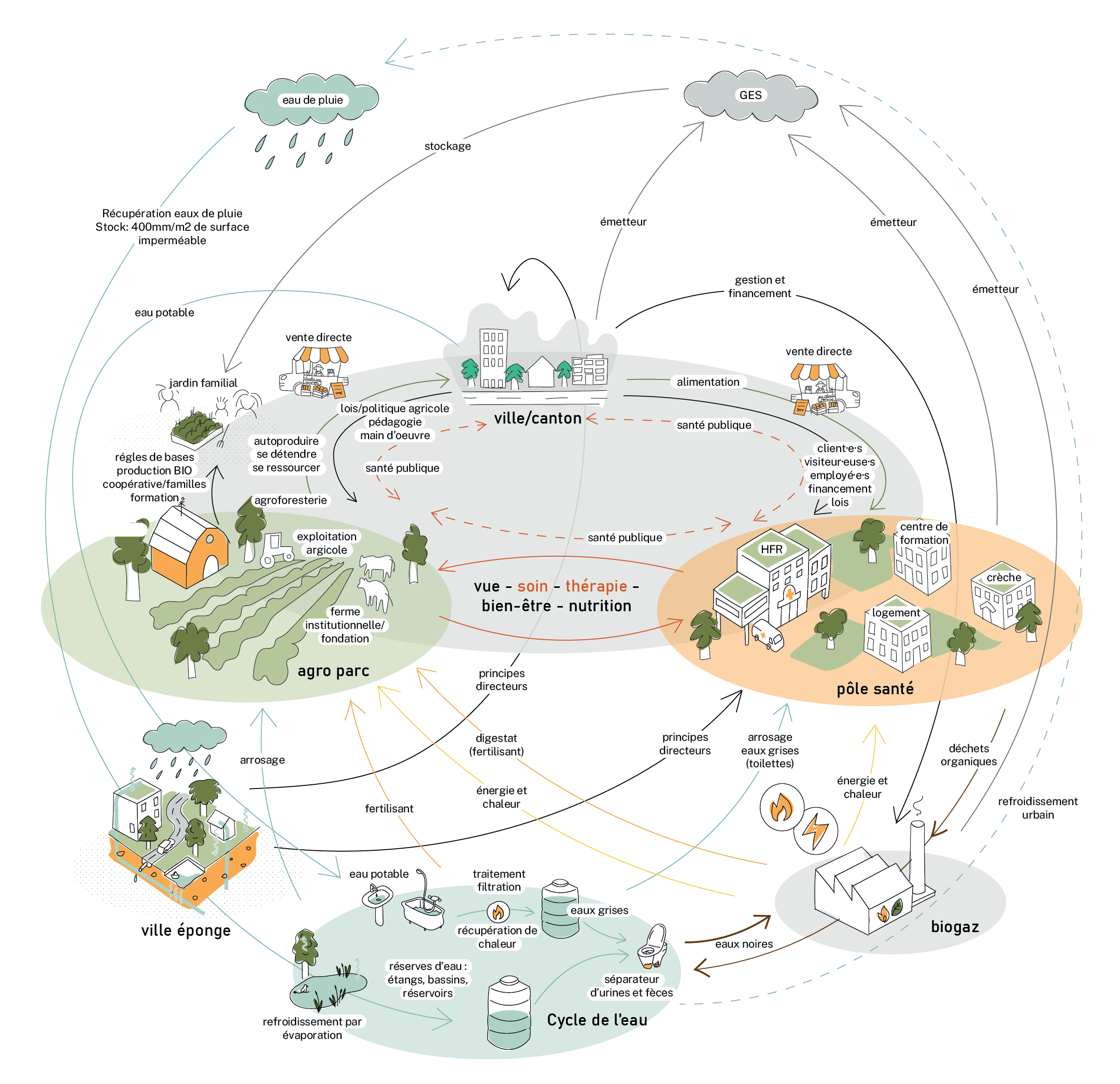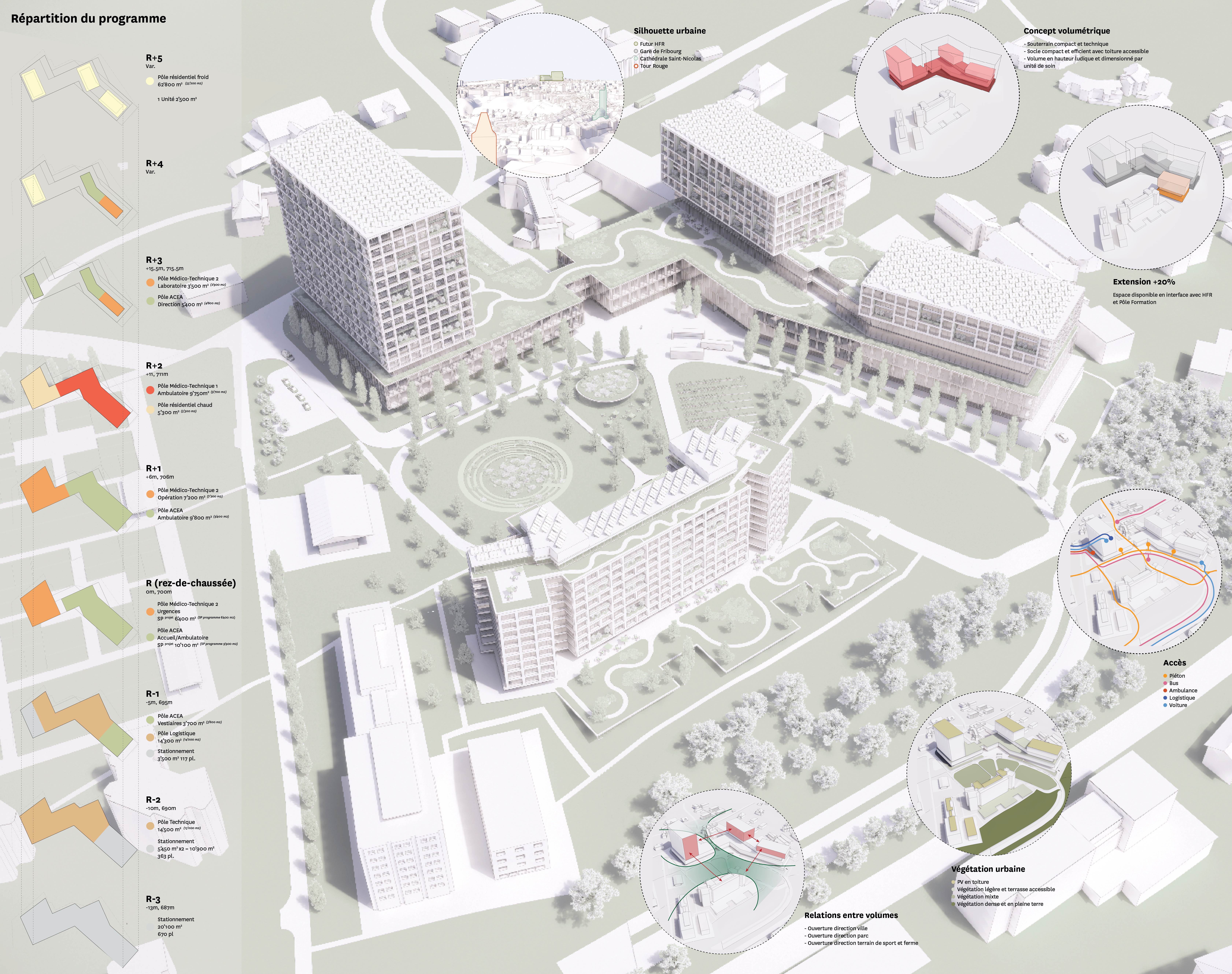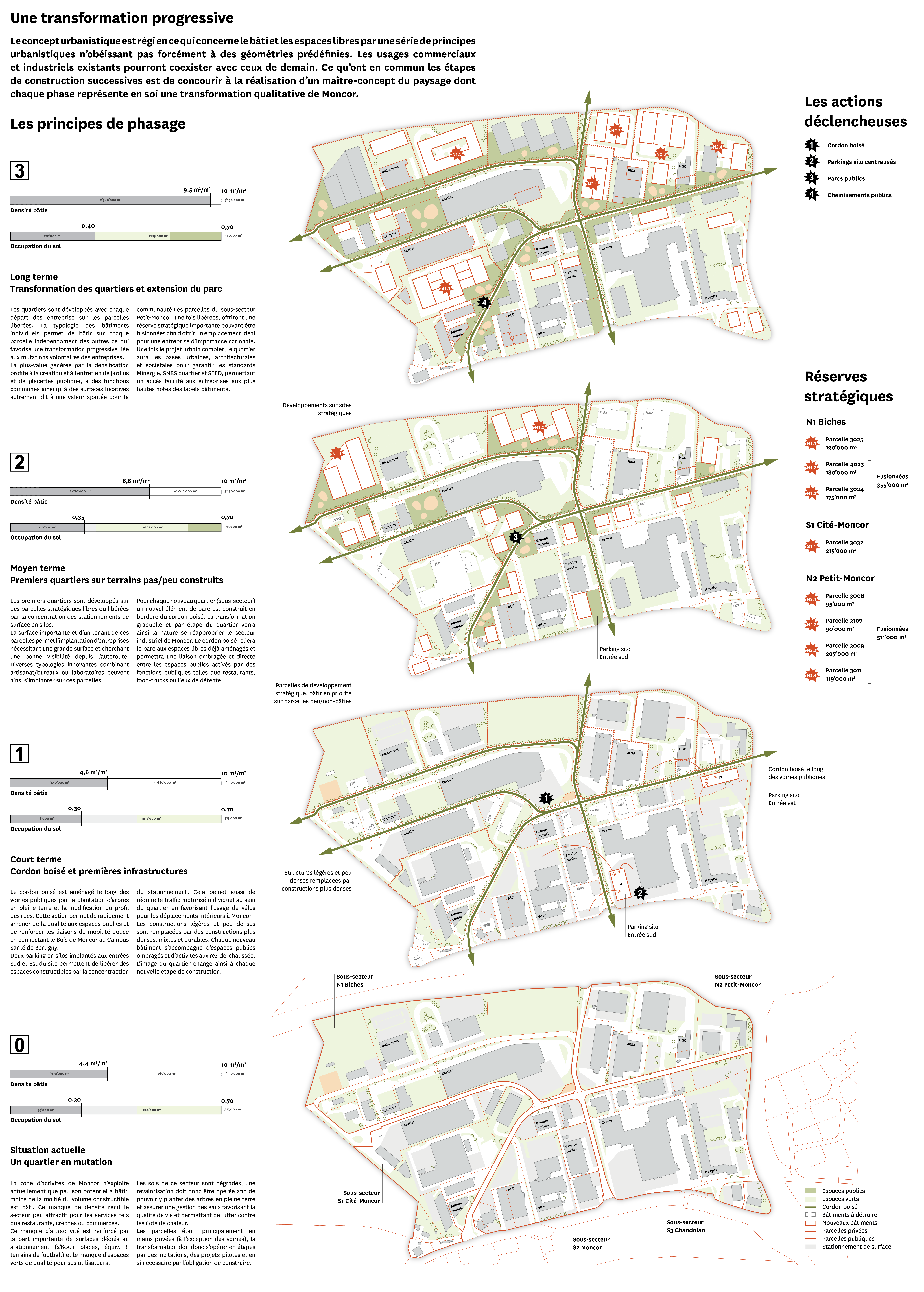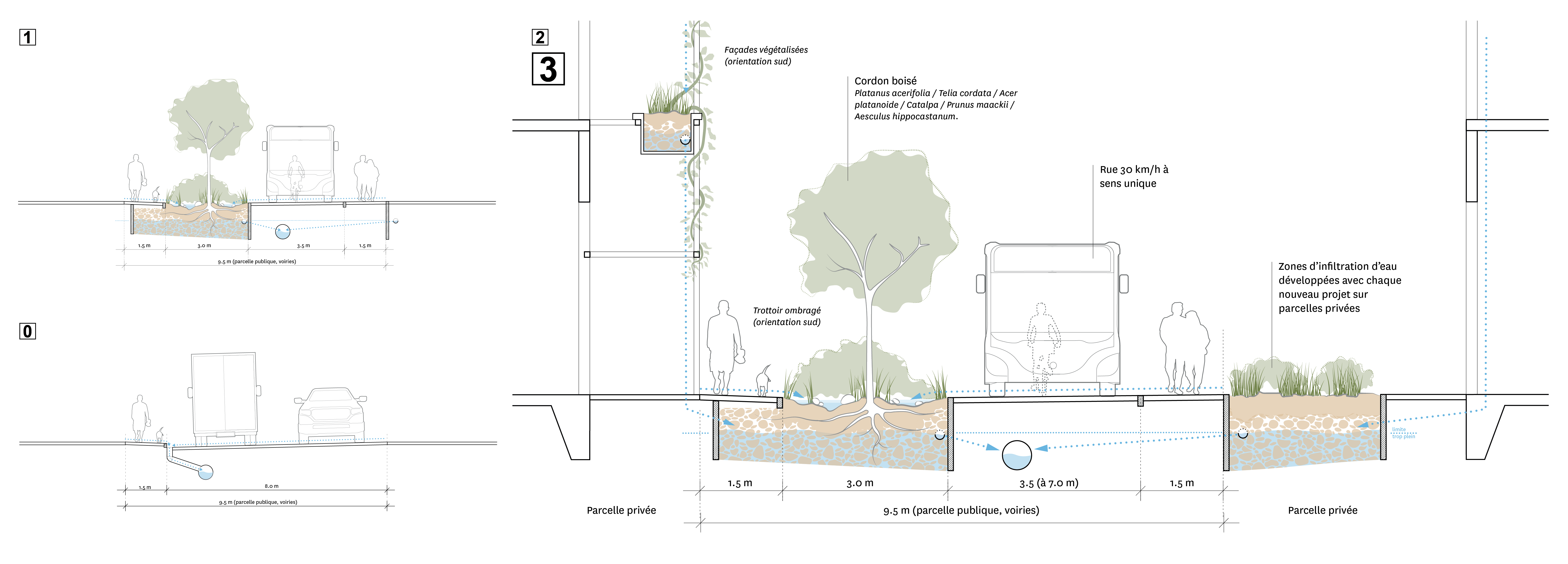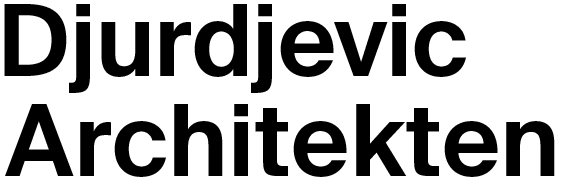014 Gesundheitspol und Aktivitäten, Fribourg
Verfahren: Studienauftrag mit Präqualifikation
Auftraggeber: Kanton Fribourg, Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt
Zeitraum: 2023–24
Geschossfläche Kantonsspital 150’000 m2, Universitätscampus 20’000 m2, Gewerbe 530’000 m2
Projektperimeter: 1’200’000 m2 (120 ha)
Nutzungen: Kantonsspital (HFR), Industrie und Gewerbe, Dienstleistung, Bildung, Parking, Kommerziel
Städtebau (Pilot): Djurdjevic Architekten, Lausanne
Muriz Djurdjevic (Projektleiter)
Architektur: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Julius Kai Lin
Architektur: IB+, Lausanne
Catherine Jaquier-Bühler, Marwen Feriani, Georgia Malapani
Landschaft: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco
Nachhaltigkeit: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz
Nachhaltigkeit: GXN Innovation, Copenhague
Lasse Lind, Mattia di Carlo
Verkehr: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer, Marius Menthonnex
Visualisierung: 3XN/GXN, Copenhague
Resilio
Das RESILIO-Projekt stellt das Gleichgewicht zwischen einer langfristigen Vision, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Unsicherheiten und der Flexibilität dar, die notwendig ist, um sich an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Es ist der am wenigsten riskante Ansatz, da es die Vorgaben erfüllt und gleichzeitig Optionen offen lässt. Er garantiert mehrere Erfolgsstufen und stellt sicher, dass die strategische Vision auch bei einer teilweisen Umsetzung Bestand hat.
Nüchternheit. Wir arbeiten mit dem "bereits Vorhandenen" und garantieren so die Einhaltung der Vorgaben zu geringeren wirtschaftlichen und ökologischen Kosten. Anstatt das Gebiet künstlich zu bebauen und die Entwicklung in eine Richtung zu blockieren, ermöglicht unser Projekt eine ständige Neubewertung der Bedürfnisse und gewährleistet ein optimales Funktionieren in einem kleineren Massstab.
Resilienz. Wir schlagen Resilienz sowohl territorial als auch in der Planung vor. Indem wir eine attraktive Stadtplanung ohne künstliche Nutzung vorschlagen, die in einem partizipativen Prozess mit den verschiedenen Interessengruppen erarbeitet wurde, verringern wir das Risiko von Einsprüchen der Nachbarn und Widerständen von Umweltverbänden. Für den Gesundheitspol und das neue Krankenhaus gewährleistet der vorgeschlagene Standort die sofortige Verfügbarkeit des Geländes, das Vorhandensein der notwendigen Netzanschlüsse (Wasser, Strom, ...) und die Kenntnis des Baugrundstücks. Dies sind drei eliminierte Hauptrisiken, die es ermöglichen, mehrere Jahre für den Bau zu gewinnen und die Kosten zu begrenzen. Auf der Ebene des Territoriums ist unsere Hauptachse die Erhaltung der Böden, denn wenn sie einmal zerstört oder verschmutzt sind, gibt es kein Zurück mehr.
Antizipation & Anpassungsfähigkeit. Unser Planungsentwurf schafft ein physisches und rechtliches Umfeld, das Unternehmen fördert, die an der Klima- und Wirtschaftspolitik des Kantons ausgerichtet sind. Durch die Vermeidung einer übermässigen Artifizialisierung bewahrt unser Ansatz die nötige Flexibilität, um den sich ändernden Bedürfnissen der Unternehmen in der Zukunft gerecht zu werden, und gewährleistet eine Reserve für den Kanton und die Gemeinde. Beim Krankenhausprojekt gewährleistet die Fähigkeit, Grösse und Nutzungen im Laufe des Projekts zu ändern, dass die Optionen so lange wie möglich erhalten bleiben. Die wirtschaftliche Entwicklung des Gewerbegebiets muss agil und anpassungsfähig sein, um künftigen Bedürfnissen gerecht zu werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Die Realisierung einer schweren Infrastruktur wie eines Krankenhauses mit dieser zu verknüpfen, ist ein strategischer Fehler. Aus diesem Grund trennen wir die Realisierung des neuen Krankenhauses vom Wirtschaftsstandort.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Zukunftsforschung
Im Oktober 2023 hat der Kanton Freiburg mit der Verabschiedung der Bodenstrategie einen bedeutenden Meilenstein gesetzt. Diese Initiative, die auf die Ernährungssicherheit, den Erhalt der Biodiversität und die Klimaresilienz ausgerichtet ist, zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Böden zu sichern und ihre ökosystemare Funktionalität zu erhalten. Parallel dazu verstärkt der kantonale Klimaplan das Engagement für den Boden- und Gewässerschutz. Das von uns vorgeschlagene Projekt fügt sich nahtlos in den Rahmen dieser kantonalen Pläne ein und schlägt somit keine totgeborene Vision vor, die sich noch vor dem ersten Spatenstich für das Krankenhaus gegen alle jüngsten strategischen Entwicklungen auf kantonaler Ebene richten würde.
Auf der Ebene der Unternehmen, deren Berücksichtigung in der Spezifikation gefordert wird, muss unbedingt die Entwicklung des nationalen und europäischen normativen Rahmens berücksichtigt werden. Für die Art von Unternehmen, auf die das Gewerbegebiet abzielt, ist ein Anstieg der Nachfrage nach Baulabels zu erwarten. Auf nationaler Ebene ist insbesondere nach der Abstimmung vom 18. Juni 2023 "Das Schweizer Volk hat über das Bundesgesetz über die Ziele des Klimaschutzes abgestimmt, (...)" mit einer Verschärfung des rechtlichen Rahmens in Bezug auf die Nachhaltigkeit und einer Verpflichtung zur Übertragung nichtfinanzieller Kriterien für mittlere bis grosse Unternehmen (die Unternehmen, auf die sich die Spezifikation bezieht) zu rechnen. Auf europäischer Ebene unterstreichen das Inkrafttreten der Richtlinie über die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) im Jahr 2023 und die davon abhängigen Anträge auf Green-Deal-Finanzierung die Bedeutung einer grösseren Transparenz und einer Verpflichtung zur Veröffentlichung eines strengen CSR-Berichts. Grosse Unternehmen werden gezwungen sein, nachhaltige Praktiken einzuführen. In diesem Zusammenhang kristallisieren sich die Wahl des Standorts für ihren neuen Standort und die Kennzeichnung von Gebäuden als wesentliche Hebel heraus. Die meisten Unternehmen haben sich für die Vergabe von Gütesiegeln entschieden, die beim Bau einer neuen Infrastruktur leicht zu implementieren sind und die es ermöglichen, die geprüften Daten im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung leichter zu übermitteln.
Unser Projekt ermöglicht durch sein Design die Erreichung von Quartierlabels wie SEED, Minergie und SNBS. Es ist jedoch entscheidend zu beachten, dass die höchsten Labelstufen der Schweiz (Minergie und SNBS) und der EU (DGNB) bei einer künstlichen Bebauung nicht erreichbar sein werden. Vor allem in der Zukunft, da die Labels ihre Anforderungen immer weiter verschärfen werden. Die Kennzeichnung des Viertels und seiner Gebäude wird die Ansiedlung von Unternehmen erleichtern, die die lokale Politik und die kantonalen Nachhaltigkeitsziele teilen, dies wird einen hohen Baustandard garantieren. Darüber hinaus wird sie Start-ups und KMU einen vorgefertigten städtischen und gebauten Rahmen mit einem sehr hohen CSR-Niveau bieten, was zu einem Attraktivitätsargument für Unternehmen wird, die diese Werte teilen.
Physikalisch-chemische Kreisläufe
Wir behandeln das Territorium als endliche Ressource, und unsere Arbeit schlägt einen Ansatz zur Resilienz durch Biodiversität und die Aufwertung von Ökosystemdienstleistungen vor. Indem wir das Territorium wie ein Lebewesen behandeln, bei dem alle Teile bedacht werden müssen, um eine Abschwächung durch Anpassung des öffentlichen Raums und der Landschaft zu gewährleisten, richten wir Ökosysteme auf der Ebene von Stadtvierteln und Städten ein. Diese nutzbringenden Beziehungen zwischen unserer Spezies und ihrer Umwelt sind nur durch die Interaktion mit und durch das Lebendige möglich. Der Boden ist dabei der wichtigste Akteur und beherbergt 25% der Biomasse der Erde. Ein lebendiger Boden speichert und filtert Wasser, ermöglicht den Anbau und prägt das Terroir. Ohne lebendigen Boden ist eine Anpassung an den Klimawandel nicht möglich. Die Natur ermöglicht es uns auch, uns zu heilen. Therapien, bei denen Tiere einbezogen werden, oder die Pflege von Pflanzen sind für ihre positiven Auswirkungen auf psychologische, neuro-psychologische und motorische Probleme bekannt. Die Ansiedlung des Gesundheitspols am Rande des Agri-Parc und in direkter Verbindung mit dem institutionellen Bauernhof ermöglicht diese Nähe zwischen dem Kranken und der Natur.
Landschaftskonzept
Das Projekt basiert auf zwei Freiburger Prinzipien, dem städtischen Plot und der landwirtschaftlichen Landschaft. Die Vegetation ist das zentrale Element, das sich mit dem gesamten Gebiet, ob landwirtschaftlich oder städtisch, vermischt. Sie schlägt einen gemeinsamen biologischen Korridor vor, der die verschiedenen Viertel miteinander verbinden wird. Die für das neue Krankenhaus gewählte Anordnung wird die Skyline von Freiburg durch ein symbolträchtiges, weithin sichtbares Gebäude markieren, das selbst einen privilegierten Zugang für die Patienten mit Ausblicken in Richtung der Alpen und des Jura bieten wird. Die Landschaft des Gebiets wird sich verändern. Im Süden wird sich ein wenig dicht besiedeltes Industrieviertel in ein gemischtes nachhaltiges Viertel mit Handwerk, Industrie und Dienstleistungen verwandeln, das sanfte Mobilität und Begegnungen fördert und in dem es dank einer Begrünung der Flächen keine Hitzeinseln mehr geben wird.
Der nördliche Teil, der Agri-Parc, wird sich in Agroforstfelder mit Hecken und Baumreihen (Keyline) verwandeln, die entlang der Höhenkurven verlaufen. Ausserdem werden diese Bäume als Futter- oder Nahrungsquelle dienen, um den Mangel an Futter in Dürreperioden zu beheben. Schrebergärten, Spazierwege und verschiedene Funktionen sollen diesen Raum bekannt machen. Der Schutz und die Dauerhaftigkeit des Ortes kommen von der gemeinsamen Erfahrung dieses Ortes. Dieser Park wird von einem urbanen Rand begrenzt, der halb bebaut, halb bepflanzt ist und den Agri-Parc konstruktiv fortsetzt. Dieser Rand wird die Gebäude des institutionellen Bauernhofs sowie soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in Leichtbauweise beherbergen, die das Leben in der Nachbarschaft fördern. Er wird wie eine Haut zwischen der Stadt und dem Park wirken.
Bodenmanagement
Trotz der bereits gewonnenen Erkenntnisse über die Bedeutung des Bodens ist die Zersiedelung in der Schweiz sehr stark, jede Sekunde geht 1 m2 verloren. Seit 1933 wurden in unserem Betrachtungsgebiet 50 ha versiegelt. Wir betrachten den landwirtschaftlichen Boden als nicht erneuerbare Ressource, was auch die Position des Bundes ist, wie sie in der Bodenstrategie des BAFU beschrieben wird. Darüber hinaus befinden sich 59 % des Lebens auf der Erde im Boden.
Deshalb sind für uns die Verdichtung dessen, was in bereits bebauten Gebieten möglich ist, und die Erhaltung von möglichst viel durchlässigem Boden eine Priorität. Diese Strategie, die dem Prinzip der Verdichtung nach innen folgt, wenden wir für den Stadtteil Moncor sowie für das neue Freiburger Krankenhaus und seinen Gesundheitspol an. Das Projekt zielt darauf ab, das Land so weit wie möglich zu erhalten, indem es eine Netto-Artifizialisierung von null anstrebt, aber vor allem soll es agrarisiert werden, d.h. die Menge an Leben, die auf ihm stattfindet, erhöht werden: durch Baumpflanzungen, Wasserinfiltrationszonen und differenzierte Pflege- und landwirtschaftliche Nutzungspraktiken, die das Bodenleben fördern und somit das Leben intensivieren.
Die Verwaltung der Familien- und Gemeinschaftsgärten wird von der institutionellen Farm übernommen, die die notwendigen Regeln zur Erhaltung des Bodens aufstellen kann, damit Verschmutzung, Verdichtung und Erosion auf ein Minimum reduziert werden und der Boden zu einem lebendigen Boden wird. Zu diesem Zweck müssen Schulungen durchgeführt werden, damit die Nutzer die Auswirkungen verstehen, die sie auf den Boden haben, das Leben, das er enthält, und die Widerstandsfähigkeit, die er bietet.
Wassermanagement
Auf Gebietsebene werden die Landwirte ermutigt, den Boden zu schonen, indem sie Bodenverdichtungen vermeiden und biologische Anbaumethoden, insbesondere Agroforstwirtschaft, anwenden. Durch das Anlegen von mit Bäumen bewachsenen Knicks (Keyline), die parallel zu den Geländekurven verlaufen, soll das Wasser besser in den Boden eindringen und die Bodenerosion vermindert werden. Denn der Boden ist der grösste Wasserspeicher, der uns zur Verfügung steht - allerdings nur, wenn er lebendig und gesund ist.
Auf städtischer Ebene versucht das Konzept der "Schwammstadt", die Auswirkungen starker Regenfälle durch die Maximierung durchlässiger Bodenflächen und die Förderung der Wasserinfiltration abzuschwächen. Zur Vermeidung von Überschwemmungen und Überflutungen werden verschiedene Instrumente wie Dachwassernutzung (Dachbegrünung), unterirdische und offene Wasserspeicher, Wasserspeicherstrassen, Retentionsgräben, bepflanzte Mulden/Gräben und Regengärten empfohlen. Das gespeicherte Wasser und die Vegetation werden so dazu beitragen, die Hitzeinseln im Sommer drastisch zu reduzieren.
Auf Gebäudeebene kann Grauwasser nach der Behandlung mit Aktivkohle für die Toilettenspülung oder die Bewässerung wiederverwendet werden, was eine erhebliche Wassereinsparung bietet. Die Trennung von Urin und Fäkalien wird gefordert, da dies zur Begrenzung der Wasserverschmutzung beiträgt und somit den Anstieg der Kosten für die Behandlung von Mikroverunreinigungen in den ARAs begrenzt. Dies gilt insbesondere für Krankenhäuser, deren Patientenurin eine Hauptquelle für Mikroverunreinigungen darstellt. Die Verwertung des Urins vor Ort, sobald ein Gebäude 500 Nutzer erreicht, sollte obligatorisch werden, wodurch eine bedeutende Produktion von lokalem und kohlenstofffreiem Dünger ermöglicht wird (Blue Factory).
Verfahren: Studienauftrag mit Präqualifikation
Auftraggeber: Kanton Fribourg, Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt
Zeitraum: 2023–24
Geschossfläche Kantonsspital 150’000 m2, Universitätscampus 20’000 m2, Gewerbe 530’000 m2
Projektperimeter: 1’200’000 m2 (120 ha)
Nutzungen: Kantonsspital (HFR), Industrie und Gewerbe, Dienstleistung, Bildung, Parking, Kommerziel
Städtebau (Pilot): Djurdjevic Architekten, Lausanne
Muriz Djurdjevic (Projektleiter)
Architektur: 3XN Architects, Copenhague
Stig Vesterager Gothelf, Antoine Béchet, Julius Kai Lin
Architektur: IB+, Lausanne
Catherine Jaquier-Bühler, Marwen Feriani, Georgia Malapani
Landschaft: Forster Paysages, Lausanne
Jan Forster, Simon Cerf-Carpentier, Michele Falco
Nachhaltigkeit: IB+, Lausanne
Arnaud Paquier, Stéphane Stutz
Nachhaltigkeit: GXN Innovation, Copenhague
Lasse Lind, Mattia di Carlo
Verkehr: RGR Ingénieurs, Lausanne
Olivier Schorer, Marius Menthonnex
Visualisierung: 3XN/GXN, Copenhague
Resilio
Das RESILIO-Projekt stellt das Gleichgewicht zwischen einer langfristigen Vision, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Unsicherheiten und der Flexibilität dar, die notwendig ist, um sich an eine sich ständig verändernde Welt anzupassen. Es ist der am wenigsten riskante Ansatz, da es die Vorgaben erfüllt und gleichzeitig Optionen offen lässt. Er garantiert mehrere Erfolgsstufen und stellt sicher, dass die strategische Vision auch bei einer teilweisen Umsetzung Bestand hat.
Nüchternheit. Wir arbeiten mit dem "bereits Vorhandenen" und garantieren so die Einhaltung der Vorgaben zu geringeren wirtschaftlichen und ökologischen Kosten. Anstatt das Gebiet künstlich zu bebauen und die Entwicklung in eine Richtung zu blockieren, ermöglicht unser Projekt eine ständige Neubewertung der Bedürfnisse und gewährleistet ein optimales Funktionieren in einem kleineren Massstab.
Resilienz. Wir schlagen Resilienz sowohl territorial als auch in der Planung vor. Indem wir eine attraktive Stadtplanung ohne künstliche Nutzung vorschlagen, die in einem partizipativen Prozess mit den verschiedenen Interessengruppen erarbeitet wurde, verringern wir das Risiko von Einsprüchen der Nachbarn und Widerständen von Umweltverbänden. Für den Gesundheitspol und das neue Krankenhaus gewährleistet der vorgeschlagene Standort die sofortige Verfügbarkeit des Geländes, das Vorhandensein der notwendigen Netzanschlüsse (Wasser, Strom, ...) und die Kenntnis des Baugrundstücks. Dies sind drei eliminierte Hauptrisiken, die es ermöglichen, mehrere Jahre für den Bau zu gewinnen und die Kosten zu begrenzen. Auf der Ebene des Territoriums ist unsere Hauptachse die Erhaltung der Böden, denn wenn sie einmal zerstört oder verschmutzt sind, gibt es kein Zurück mehr.
Antizipation & Anpassungsfähigkeit. Unser Planungsentwurf schafft ein physisches und rechtliches Umfeld, das Unternehmen fördert, die an der Klima- und Wirtschaftspolitik des Kantons ausgerichtet sind. Durch die Vermeidung einer übermässigen Artifizialisierung bewahrt unser Ansatz die nötige Flexibilität, um den sich ändernden Bedürfnissen der Unternehmen in der Zukunft gerecht zu werden, und gewährleistet eine Reserve für den Kanton und die Gemeinde. Beim Krankenhausprojekt gewährleistet die Fähigkeit, Grösse und Nutzungen im Laufe des Projekts zu ändern, dass die Optionen so lange wie möglich erhalten bleiben. Die wirtschaftliche Entwicklung des Gewerbegebiets muss agil und anpassungsfähig sein, um künftigen Bedürfnissen gerecht zu werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Die Realisierung einer schweren Infrastruktur wie eines Krankenhauses mit dieser zu verknüpfen, ist ein strategischer Fehler. Aus diesem Grund trennen wir die Realisierung des neuen Krankenhauses vom Wirtschaftsstandort.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Zukunftsforschung
Im Oktober 2023 hat der Kanton Freiburg mit der Verabschiedung der Bodenstrategie einen bedeutenden Meilenstein gesetzt. Diese Initiative, die auf die Ernährungssicherheit, den Erhalt der Biodiversität und die Klimaresilienz ausgerichtet ist, zielt darauf ab, qualitativ hochwertige Böden zu sichern und ihre ökosystemare Funktionalität zu erhalten. Parallel dazu verstärkt der kantonale Klimaplan das Engagement für den Boden- und Gewässerschutz. Das von uns vorgeschlagene Projekt fügt sich nahtlos in den Rahmen dieser kantonalen Pläne ein und schlägt somit keine totgeborene Vision vor, die sich noch vor dem ersten Spatenstich für das Krankenhaus gegen alle jüngsten strategischen Entwicklungen auf kantonaler Ebene richten würde.
Auf der Ebene der Unternehmen, deren Berücksichtigung in der Spezifikation gefordert wird, muss unbedingt die Entwicklung des nationalen und europäischen normativen Rahmens berücksichtigt werden. Für die Art von Unternehmen, auf die das Gewerbegebiet abzielt, ist ein Anstieg der Nachfrage nach Baulabels zu erwarten. Auf nationaler Ebene ist insbesondere nach der Abstimmung vom 18. Juni 2023 "Das Schweizer Volk hat über das Bundesgesetz über die Ziele des Klimaschutzes abgestimmt, (...)" mit einer Verschärfung des rechtlichen Rahmens in Bezug auf die Nachhaltigkeit und einer Verpflichtung zur Übertragung nichtfinanzieller Kriterien für mittlere bis grosse Unternehmen (die Unternehmen, auf die sich die Spezifikation bezieht) zu rechnen. Auf europäischer Ebene unterstreichen das Inkrafttreten der Richtlinie über die soziale Verantwortung von Unternehmen (CSR) im Jahr 2023 und die davon abhängigen Anträge auf Green-Deal-Finanzierung die Bedeutung einer grösseren Transparenz und einer Verpflichtung zur Veröffentlichung eines strengen CSR-Berichts. Grosse Unternehmen werden gezwungen sein, nachhaltige Praktiken einzuführen. In diesem Zusammenhang kristallisieren sich die Wahl des Standorts für ihren neuen Standort und die Kennzeichnung von Gebäuden als wesentliche Hebel heraus. Die meisten Unternehmen haben sich für die Vergabe von Gütesiegeln entschieden, die beim Bau einer neuen Infrastruktur leicht zu implementieren sind und die es ermöglichen, die geprüften Daten im Rahmen der nichtfinanziellen Berichterstattung leichter zu übermitteln.
Unser Projekt ermöglicht durch sein Design die Erreichung von Quartierlabels wie SEED, Minergie und SNBS. Es ist jedoch entscheidend zu beachten, dass die höchsten Labelstufen der Schweiz (Minergie und SNBS) und der EU (DGNB) bei einer künstlichen Bebauung nicht erreichbar sein werden. Vor allem in der Zukunft, da die Labels ihre Anforderungen immer weiter verschärfen werden. Die Kennzeichnung des Viertels und seiner Gebäude wird die Ansiedlung von Unternehmen erleichtern, die die lokale Politik und die kantonalen Nachhaltigkeitsziele teilen, dies wird einen hohen Baustandard garantieren. Darüber hinaus wird sie Start-ups und KMU einen vorgefertigten städtischen und gebauten Rahmen mit einem sehr hohen CSR-Niveau bieten, was zu einem Attraktivitätsargument für Unternehmen wird, die diese Werte teilen.
Physikalisch-chemische Kreisläufe
Wir behandeln das Territorium als endliche Ressource, und unsere Arbeit schlägt einen Ansatz zur Resilienz durch Biodiversität und die Aufwertung von Ökosystemdienstleistungen vor. Indem wir das Territorium wie ein Lebewesen behandeln, bei dem alle Teile bedacht werden müssen, um eine Abschwächung durch Anpassung des öffentlichen Raums und der Landschaft zu gewährleisten, richten wir Ökosysteme auf der Ebene von Stadtvierteln und Städten ein. Diese nutzbringenden Beziehungen zwischen unserer Spezies und ihrer Umwelt sind nur durch die Interaktion mit und durch das Lebendige möglich. Der Boden ist dabei der wichtigste Akteur und beherbergt 25% der Biomasse der Erde. Ein lebendiger Boden speichert und filtert Wasser, ermöglicht den Anbau und prägt das Terroir. Ohne lebendigen Boden ist eine Anpassung an den Klimawandel nicht möglich. Die Natur ermöglicht es uns auch, uns zu heilen. Therapien, bei denen Tiere einbezogen werden, oder die Pflege von Pflanzen sind für ihre positiven Auswirkungen auf psychologische, neuro-psychologische und motorische Probleme bekannt. Die Ansiedlung des Gesundheitspols am Rande des Agri-Parc und in direkter Verbindung mit dem institutionellen Bauernhof ermöglicht diese Nähe zwischen dem Kranken und der Natur.
Landschaftskonzept
Das Projekt basiert auf zwei Freiburger Prinzipien, dem städtischen Plot und der landwirtschaftlichen Landschaft. Die Vegetation ist das zentrale Element, das sich mit dem gesamten Gebiet, ob landwirtschaftlich oder städtisch, vermischt. Sie schlägt einen gemeinsamen biologischen Korridor vor, der die verschiedenen Viertel miteinander verbinden wird. Die für das neue Krankenhaus gewählte Anordnung wird die Skyline von Freiburg durch ein symbolträchtiges, weithin sichtbares Gebäude markieren, das selbst einen privilegierten Zugang für die Patienten mit Ausblicken in Richtung der Alpen und des Jura bieten wird. Die Landschaft des Gebiets wird sich verändern. Im Süden wird sich ein wenig dicht besiedeltes Industrieviertel in ein gemischtes nachhaltiges Viertel mit Handwerk, Industrie und Dienstleistungen verwandeln, das sanfte Mobilität und Begegnungen fördert und in dem es dank einer Begrünung der Flächen keine Hitzeinseln mehr geben wird.
Der nördliche Teil, der Agri-Parc, wird sich in Agroforstfelder mit Hecken und Baumreihen (Keyline) verwandeln, die entlang der Höhenkurven verlaufen. Ausserdem werden diese Bäume als Futter- oder Nahrungsquelle dienen, um den Mangel an Futter in Dürreperioden zu beheben. Schrebergärten, Spazierwege und verschiedene Funktionen sollen diesen Raum bekannt machen. Der Schutz und die Dauerhaftigkeit des Ortes kommen von der gemeinsamen Erfahrung dieses Ortes. Dieser Park wird von einem urbanen Rand begrenzt, der halb bebaut, halb bepflanzt ist und den Agri-Parc konstruktiv fortsetzt. Dieser Rand wird die Gebäude des institutionellen Bauernhofs sowie soziale und wirtschaftliche Aktivitäten in Leichtbauweise beherbergen, die das Leben in der Nachbarschaft fördern. Er wird wie eine Haut zwischen der Stadt und dem Park wirken.
Bodenmanagement
Trotz der bereits gewonnenen Erkenntnisse über die Bedeutung des Bodens ist die Zersiedelung in der Schweiz sehr stark, jede Sekunde geht 1 m2 verloren. Seit 1933 wurden in unserem Betrachtungsgebiet 50 ha versiegelt. Wir betrachten den landwirtschaftlichen Boden als nicht erneuerbare Ressource, was auch die Position des Bundes ist, wie sie in der Bodenstrategie des BAFU beschrieben wird. Darüber hinaus befinden sich 59 % des Lebens auf der Erde im Boden.
Deshalb sind für uns die Verdichtung dessen, was in bereits bebauten Gebieten möglich ist, und die Erhaltung von möglichst viel durchlässigem Boden eine Priorität. Diese Strategie, die dem Prinzip der Verdichtung nach innen folgt, wenden wir für den Stadtteil Moncor sowie für das neue Freiburger Krankenhaus und seinen Gesundheitspol an. Das Projekt zielt darauf ab, das Land so weit wie möglich zu erhalten, indem es eine Netto-Artifizialisierung von null anstrebt, aber vor allem soll es agrarisiert werden, d.h. die Menge an Leben, die auf ihm stattfindet, erhöht werden: durch Baumpflanzungen, Wasserinfiltrationszonen und differenzierte Pflege- und landwirtschaftliche Nutzungspraktiken, die das Bodenleben fördern und somit das Leben intensivieren.
Die Verwaltung der Familien- und Gemeinschaftsgärten wird von der institutionellen Farm übernommen, die die notwendigen Regeln zur Erhaltung des Bodens aufstellen kann, damit Verschmutzung, Verdichtung und Erosion auf ein Minimum reduziert werden und der Boden zu einem lebendigen Boden wird. Zu diesem Zweck müssen Schulungen durchgeführt werden, damit die Nutzer die Auswirkungen verstehen, die sie auf den Boden haben, das Leben, das er enthält, und die Widerstandsfähigkeit, die er bietet.
Wassermanagement
Auf Gebietsebene werden die Landwirte ermutigt, den Boden zu schonen, indem sie Bodenverdichtungen vermeiden und biologische Anbaumethoden, insbesondere Agroforstwirtschaft, anwenden. Durch das Anlegen von mit Bäumen bewachsenen Knicks (Keyline), die parallel zu den Geländekurven verlaufen, soll das Wasser besser in den Boden eindringen und die Bodenerosion vermindert werden. Denn der Boden ist der grösste Wasserspeicher, der uns zur Verfügung steht - allerdings nur, wenn er lebendig und gesund ist.
Auf städtischer Ebene versucht das Konzept der "Schwammstadt", die Auswirkungen starker Regenfälle durch die Maximierung durchlässiger Bodenflächen und die Förderung der Wasserinfiltration abzuschwächen. Zur Vermeidung von Überschwemmungen und Überflutungen werden verschiedene Instrumente wie Dachwassernutzung (Dachbegrünung), unterirdische und offene Wasserspeicher, Wasserspeicherstrassen, Retentionsgräben, bepflanzte Mulden/Gräben und Regengärten empfohlen. Das gespeicherte Wasser und die Vegetation werden so dazu beitragen, die Hitzeinseln im Sommer drastisch zu reduzieren.
Auf Gebäudeebene kann Grauwasser nach der Behandlung mit Aktivkohle für die Toilettenspülung oder die Bewässerung wiederverwendet werden, was eine erhebliche Wassereinsparung bietet. Die Trennung von Urin und Fäkalien wird gefordert, da dies zur Begrenzung der Wasserverschmutzung beiträgt und somit den Anstieg der Kosten für die Behandlung von Mikroverunreinigungen in den ARAs begrenzt. Dies gilt insbesondere für Krankenhäuser, deren Patientenurin eine Hauptquelle für Mikroverunreinigungen darstellt. Die Verwertung des Urins vor Ort, sobald ein Gebäude 500 Nutzer erreicht, sollte obligatorisch werden, wodurch eine bedeutende Produktion von lokalem und kohlenstofffreiem Dünger ermöglicht wird (Blue Factory).